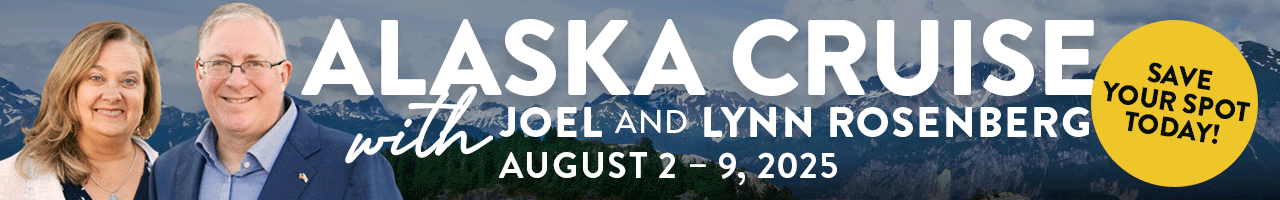Die hebräischen Dialekte der Diaspora retten, bevor sie verschwinden

Viele der hebräischen Dialekte, die sich im Laufe der Jahrtausende in der Zerstreuung entwickelt haben, sind in Gefahr, für immer verloren zu gehen, aber die israelische Akademie für die hebräische Sprache ist entschlossen, so viele wie möglich zu retten.
Hebräisch, so heißt es oft, ist die einzige „tote“ Sprache, die wiederbelebt wurde. Dennoch wurde die Sprache während der 2.000-jährigen Diaspora Israels weiterhin auf unterschiedliche Weise verwendet, auch wenn sie nicht als Muttersprache gesprochen wurde.
„Hebräisch wurde als Kultursprache von Juden auf der ganzen Welt bewahrt – sie lernten, schrieben und vor allem lasen sie hebräische Texte laut. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte die Sprache in der Moderne nicht wiederbelebt werden können“, erklärt Doron Yaakov, ein Forscher, der für die Sammlung jüdischer mündlicher Überlieferungen an der Akademie verantwortlich ist.
Ironischerweise ist es ausgerechnet der Effizienz der Akademie der Hebräischen Sprache zu verdanken, dass die Unterschiede zwischen den Dialekten zunehmend verloren gehen, berichtet die Times of Israel. Die Bemühungen, die Sprache bei ihrer Wiedereinführung zu vereinfachen und zu standardisieren, haben viele Varianten ausgelöscht.
Im Kultur- und Bildungszentrum der Akademie der Hebräischen Sprache auf dem Givat-Ram-Campus der Hebräischen Universität wurde für Besucher ein multisensorisches Erlebnis konzipiert. Mithilfe von Bildern, Licht und Ton dokumentiert die Akademie kulturelle Varianten der Sprache, wie sie an unterschiedlichen Orten weltweit gesprochen wurde.
So wie der Satz „The quick brown fox jumps over the lazy dog“ genutzt wird, um feine Unterschiede in der Typografie aufzuzeigen, werden hier die ersten Verse der Genesis in mehreren Dialekten gesprochen, sodass Zuhörer subtile Unterschiede heraushören können. Die Verse werden von Sprechern aus dem Jemen, Polen, Italien, Marokko und anderen Ländern vorgelesen – alles Dialekte, die vom Aussterben bedroht sind.
Die Akademie der Hebräischen Sprache wurde 1953 als Weiterentwicklung des Sprachkomitees gegründet, das 1890 von Eliezer Ben Yehuda ins Leben gerufen wurde, der als „Vater des modernen Hebräisch“ gilt. Ben Yehuda belebte die biblische Sprache fast im Alleingang wieder und schien seine Mission – zumindest anfangs – als göttlich inspiriert zu betrachten. Er schrieb: „Ich hörte eine innere Stimme, die mir zurief: ‚Erwecke Israel und seine Sprache im Land der Väter!‘“
Das Sprachkomitee, das sich darum bemühte, das moderne Hebräisch mit neuen Regeln für Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung so einfach wie möglich zu gestalten, sowie mit vielen neuen Wörtern, die zuvor nicht existierten, arbeitet heute daran, die Besonderheiten verschiedener hebräischer Dialekte zu katalogisieren. Als Akademie der Hebräischen Sprache setzen sich die Wissenschaftler nun dafür ein, einen wichtigen Aspekt der jüdischen Geschichte zu bewahren.
Über die genaue Ursprungszeit der hebräischen Sprache wird noch immer diskutiert, aber es wurden Inschriften mit hebräischen Buchstaben gefunden, die rund 3.000 Jahre alt sind. Sicher ist, dass Hebräisch in biblischer Zeit verbreitet gesprochen wurde, jedoch ab dem 5. Jahrhundert n. Chr. langsam aus dem alltäglichen Sprachgebrauch verschwand – bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
„Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs sprachen nur wenige Menschen im Land Hebräisch im Alltag, aber Hunderte von Gemeinden wussten, wie man es in ihren eigenen einzigartigen Aussprachen liest und spricht“, sagte Yaakov der Times of Israel. Textliche Belege zeigen, dass regionale Varianten bereits vor 2.000 Jahren entstanden, als sich die jüdischen Gemeinschaften ausbreiteten.
„Der babylonische Talmud berichtet, dass es in Galiläa Juden gab, die das ‚Chet‘ und ‚Ayin‘ nicht richtig aussprechen konnten und deshalb als weniger geeignet galten, um das Gebet zu leiten“, erzählte er.
„Wenn wir die hebräische Tradition betrachten, die unter sephardischen Gemeinden im Irak und in Nordafrika verbreitet war, dann basiert sie auf dem Hebräisch, das im Land Israel zur Zeit des Zweiten Tempels gesprochen wurde“, erklärte Yaakov weiter. „Die jemenitische hebräische Aussprache spiegelt hingegen die Sprache Babylons wider.“
Yaakov erläuterte auch, dass es im Jiddischen keinen Laut für das hebräische „Chet“ gibt, weshalb viele Jiddischsprecher diesen Laut nicht aussprechen können. Interessanterweise aber, obwohl es im Arabischen keinen „P“-Laut gibt, haben Juden in arabischsprachigen Ländern den Unterschied zwischen „P“ und „F“, also zwischen Peh und Pheh im Hebräischen, erhalten.
Außerdem berichtete er, dass diejenige Volksgruppe, deren hebräische Aussprache der vorkriegszeitlichen am nächsten kommt, überraschenderweise die der Samaritaner ist. „Sie sind die einzige nicht-jüdische Gemeinschaft, die eine hebräische Tradition bewahrt hat“, so Yaakov. „Sie haben eine hebräische Aussprache erhalten, wie sie im Land Israel zur Zeit des Zweiten Tempels existierte.“
Die Sammlung jüdischer mündlicher Überlieferungen entstand kurz nach der Gründung des Staates Israel, um die Sprachtraditionen und Dialekte zu bewahren, die durch das moderne standardisierte Hebräisch sonst „verschluckt“ worden wären, sagte Yaakov.
Prof. Shlomo Morag von der Hebräischen Universität widmete 40 Jahre der Aufnahme hebräischer Sprecher aus aller Welt. „In den 1950er-Jahren begann er, Aufnahmezentren, Baracken für Neueinwanderer und Synagogen mit einem großen Aufnahmegerät zu besuchen“, sagte Yaakov. „Er identifizierte Experten aus verschiedenen Gemeinden, die er dokumentieren konnte.“ Insgesamt nahm er etwa 250 Menschen aus 30 Ländern für das Forschungszentrum für jüdische mündliche Überlieferung auf.
„Diese Aufnahmen sind die einzigen Zeugnisse dieser hebräischen Aussprachen“, sagte Yaakov begeistert. „Forschungen zeigen, dass selbst wenn manche Nachfahren dieser Gemeinden den Akzent teilweise in ihren religiösen Riten bewahrt haben, viele seiner Nuancen dennoch verloren gegangen sind.“
Sprache besitzt eine große Kraft – sie erreicht das Herz, vermittelt Kultur und bewahrt Geschichte. Wie nationale Schätze wurden im Jahr 2017 rund 2.500 Stunden Aufnahmen verschiedener Dialekte der Akademie anvertraut. Sie werden derzeit digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Jo Elizabeth interessiert sich sehr für Politik und kulturelle Entwicklungen. Sie hat Sozialpolitik studiert und einen Master in Jüdischer Philosophie an der Universität Haifa erworben, schreibt aber am liebsten über die Bibel und ihr Hauptthema, den Gott Israels. Als Schriftstellerin verbringt Jo ihre Zeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Jerusalem, Israel.